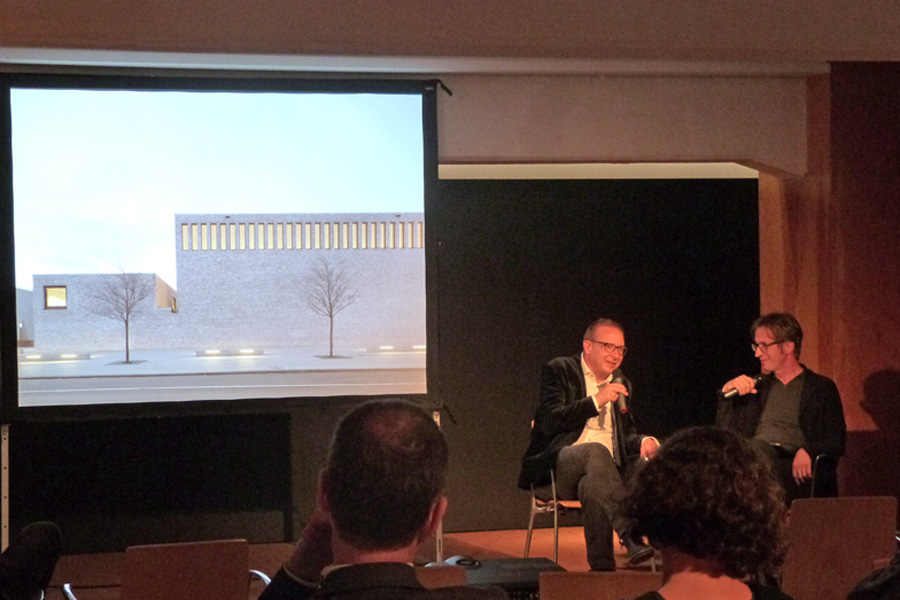Braucht die Stadt Visionen?
Oder ist diese Liaison sogar gefährlich? Anschaulich und auch provozierend erläuterte der Stuttgarter Architekt Martin Bez, dass eine Stadt wie ein Organismus wachsen müsse, um lebendig zu bleiben – aber mit Bedacht.
In seinem Impulsvortrag beim 27. Herforder Architekturgespräch ging es Bez vor allem um das Bauen als öffentliche Aufgabe und die daraus abgeleitete Verantwortung der Architekt*innen. Beispielhaft zeigte er das Bild von Stadt auf, das der Haltung und den Bauten des Büros Bez+Kock in Stuttgart voransteht. Das Architekturbüro, gemeinsam mit Thorsten Kock 2001 gegründet, hat sich gerade auch mit (erfolgreichen) Wettbewerbsteilnahmen und zahlreichen Auszeichnungen einen Namen gemacht.
„Jedes Haus produziert ein Stück Stadt, partizipiert an der Stadt“
Bez veranschaulichte seine Auffassung einer lebenswerten Stadt beginnend mit historischen Ansichten, u.a. mit einem Schwarzplan, einer in der Stadtplanung gängigen Darstellungsweise mit bebauten Flächen (in Schwarz sichtbar) und unbebauten (in Weiß), zurückgehend auf Giovanni Battista Nollis Planwerk der Stadt Rom (Mitte 18. Jh.). Welchen (öffentlichen) Raum gibt es in der Stadt? Was schätzen wir an ihr und was macht für uns städtisches Leben (heute) aus? „Öffentlicher Raum ist Voraussetzung städtischen Lebens. Im öffentlichen Raum spiegelt sich das Verhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft. Durch ihn wird Stadt erst zur Stadt“, so zitierte Bez Hans Paul Bahrdt, der mit seiner stadtsoziologischen Theorie („Die moderne Großstadt“) Anfang der 1960er Jahre großen Einfluss auf den Städtebau der vergangenen Jahrzehnte nahm. Für gelungene Orte urbanen Lebens – als Beispiel nannte er u.a. das Kopenhagener Stadtbad – sei die Zugänglichkeit und eine Lebendigkeit entscheidend, eine „Interaktion von Haus und Stadt“, so dass Menschen sich dort gerne aufhalten. Dabei spiele die Erdgeschossgestaltung eine bedeutende Rolle insofern, dass ein eigentlich geschlossener Raum eines Gebäudes dort dem öffentlichen Leben geöffnet werden könne.

Wie planbar ist Stadt?
„Als Architekt muss man den Geist des Ortes lesen und zeitgenössische Ideen für den spezifischen Ort entwickeln.“ In diesem Zusammenhang beschrieb Bez seine Wahrnehmung der Stadt Rom als „Museum“, in der es eher vermieden würde, Neues zu bauen: „Was bringt diese Musealisierung? – Es gilt, mit Bedacht und in Respekt vor Ort und Bestand Neues zu wagen.“ Wie ein Organismus, dessen Zellen sich stets erneuern, sei es für eine Stadt notwendig, sich durch die Erneuerung von (wenigen) Gebäuden vor Musealisierung zu schützen. Seiner Meinung nach zeigt beispielsweise der Erweiterungsbau des Landesmuseums für Kunst und Kultur in Münster (durch staab architekten, Berlin) eine zeitgemäße Auseinandersetzung sowie Verbindung von Bestand und Neubau. Ein Haus müsse als „kontextueller Solitär“ sowohl für sich stehen als auch im Ensemble spielen können und sich mit dem Stadtbild verzahnen.
Anhand folgender eigener Projekte u.a. stellte der Referent Haltung und Arbeitsweise des Büros Bez + Kock vor und auch dem Publikum zur Diskussion: Die Oberösterreichische Landesbibliothek Linz (2010), Anneliese Brost Musikforum Ruhr Bochum (2016), Stadthalle Lohr (2016), Bürgerdienste der Stadt Ulm (2019)
… und beantwortete im Nachklang der Veranstaltung einige Fragen:
Was ist aus Ihrer Sicht gute Architektur?
Gute Architektur ist die sensible Fortschreibung eines vorgefundenen Ortes. Sie muss den Außenraum interpretieren und den Innenraum neu erfinden. Gebäudestruktur und Typologie sollten dabei stets einer projektspezifisch stimmigen Logik folgen. Jedes Haus sollte eine eigenständige Geschichte erzählen. Die sorgfältige Auswahl der Baustoffe, sowie deren materialgerechte handwerkliche Verarbeitung tragen darüber hinaus ganz erheblich dazu bei, ob uns ein Haus berührt und somit zu guter Architektur wird.
Wie würden Sie eine gelungene Beziehung oder Interaktion zwischen Haus und Stadt beschreiben?
Das Volumen eines jeden Hauses definiert zwangsläufig auch einen Außenraum. Insofern zeigt sich jeder Architekt oder jede Architektin eines Hauses auch für die Qualität des umgebenden Stadtraumes verantwortlich. Es liegt an ihm, auch diesem Zwischenraum die richtige Proportion zu geben und dafür Sorge zu tragen, dass insbesondere die Erdgeschosszone des Hauses dialogfähig zu ihrer Umgebung ist. Die Bereitschaft zur Interaktion von Haus und Stadt ist eine unverzichtbare Grundlage für einen lebendigen Stadtraum.
In welcher Form sind Veränderungen in den Städten notwendig und wünschenswert oder welche Vision wäre auch „gefährlich“?
Das traditionelle Stadtgefüge gleicht einem Organismus, der aus sich heraus in der Lage ist, sich an veränderte Rahmenbedingungen anzupassen. Dies ist allerdings ein eher langsamer Prozess, der auch Geduld erfordert. Es geht nicht darum, Stadt so zu konservieren, wie sie ist. Stadt muss wachsen und sich entwickeln dürfen, um lebendig zu bleiben. Wenn Planer jedoch versuchen, Stadt am Reißbrett neu zu erfinden oder mit allzu großer Gewalt in den Stadtbaukörper einzugreifen, um ihre Visionen zu verwirklichen, so halten wir das eher für gefährlich. Jedes Experiment beinhaltet auch die Gefahr des Scheiterns – und dafür sollten wir die Stadt nicht aufs Spiel setzen.
Welches Gebäude hätten Sie gerne selbst entworfen oder welches Ihrer Projekte würden Sie als besonders überzeugend bezeichnen?
Über unsere Architektur mögen andere urteilen, aber natürlich gibt es Häuser und Architekten, die mich bei der täglichen Entwurfsarbeit ständig begleiten und inspirieren. Der französische Architekt Gilles Perraudin, bei dem ich vor über 20 Jahren als junger Architekt einige Zeit arbeiten durfte, hat beispielsweise einige Gebäude realisiert, die mich sehr berühren. Er arbeitet häufig mit großformatigen Natursteinblöcken, die er zu kraftvollen Häusern und Ensembles fügt. Seinen Bauten wohnt eine Archaik inne, die ihresgleichen sucht. Sie sind gleichermaßen klassisch und modern und verfügen über eine wunderbare Materialhaftigkeit. Spontan fällt mir das Weingut im südfranzösischen Vauvert ein, das er Mitte der neunziger Jahre errichtet hat. Ein sehr schöner Ort.
Wenn Sie vor ca. 20 Jahren das Marta Herford hätten planen können, wie würde es aussehen?
Das wäre natürlich auch für unser Büro eine sehr spannende Aufgabe gewesen, die allerdings sicherlich zu einem völlig anderen Ergebnis geführt hätte. Unsere Architektur ist für gewöhnlich weniger expressiv, als der doch sehr subjektive und persönliche Ansatz von Frank Gehry. Unsere Arbeiten entstehen in der Regel eher aus einer objektiven Logik von Ort und Funktion und spielen auf einer deutlich ruhigeren gestalterischen Klaviatur. Die persönliche architektonische Interpretation der Bauaufgabe steht bei uns nicht an erster Stelle. Da entsprechend unserer Arbeitsweise jedes Haus seine eigene projektspezifische Genese durchläuft, kann ich Ihnen leider im Voraus nicht sagen, ob es rund oder eckig, leicht oder schwer geworden wäre. Das käme auf einen Versuch an.
Hinweis: Das nächste Herforder Architekturgespräch findet am 25. September um 20:00 Uhr in der Marta-Lobby statt.