Der #KultBlick aus der Öffentlichkeitsarbeit
Lange bevor ich Kunstgeschichte studierte habe, waren Museen für mich persönliche Zufluchtsorte, die ich am liebsten alleine besuchte. Für mich stand dabei vor allem die direkte, unverfälschte Begegnung mit den Originalen im Vordergrund. Ausstellungskataloge und Monographien waren schön und gut, aber die echte Magie spürte ich nur in Museen.
In dieser Zeit waren für mich weder das Ausstellungskonzept, noch präzise formulierte Labels wichtig. Ich wollte vor allem dem Original begegnen, so nah wie eben möglich den Pinselduktus eines Künstlers nachvollziehen, Skulpturen aus verschiedenen Perspektiven entdecken und somit Kunst mit den Sinnen wahrnehmen.
Eine Ausstellung, die mich nachhaltig beeindruckte war „Faszination Venus – Bilder einer Göttin von Cranach bis Cabanel“ im Kölner Wallraff-Richartz-Museum im Jahre 2000. Dies war meine erste bewusste Begegnung mit solch prominenten Originalen wie Cranach oder Botticelli und sie prägte mich nachhaltig bis heute. Und obwohl ich mit den großen Besucherströmen um den besten Platz im Angesicht der großen Werke rang, war es einer der emotionalsten Ausstellungsbesuche, an die ich mich erinnere, denn es brauchte für mich zu dieser Zeit eben nicht mehr als das Original für ein gelungenes Kulturerlebnis.
Der Verlust von Leichtigkeit
Heute ist vieles anders: Die Kunst gehört glücklicherweise zu meinem Berufsalltag, aber damit hat sich auch meine Unvoreingenommenheit verabschiedet. Das professionelle Auseinandersetzen mit Ausstellungsinhalten und deren Kommunikation hat meinen unbedachten und wertfreien Blick verändert. Mein #KultBlick ist zielbewusster, oftmals angestrengter und manchmal zu übertrieben kritisch. Wenn ich durch eine Ausstellung gehe, ertappe ich mich dabei, dass ich alles hinterfrage: Hat das Thema der Ausstellung Relevanz? Ist das Konzept schlüssig? Welche Werke hätte man noch ergänzen können? Obwohl ich keine Kuratorin bin, überlege ich mir auch, wie ich das Thema umgesetzt hätte. Diese Fragen beschäftigen mich natürlich nicht nur, wenn ich andere Häuser besuche, sondern natürlich auch in jeder Marta-Ausstellung. Kritisches Hinterfragen ist mehr als wichtig – ohne Zweifel, aber es bedeutet im Hinblick auf den privaten Museumsbesuch einen gewissen Verlust von Leichtigkeit.
Der #KultBlick aus der Öffentlichkeitsarbeit
Mein einschneidendes Kulturerlebnis im Wallraf-Richartz-Museum fand noch in analogen Zeitalter statt, als mir Bewertungen nicht durch Google, sondern durch persönliche Gespräche zugetragen wurden und als ich mich während eines Ausstellungsbesuchs nicht ständig gefragt habe, welches Werk sich wohl gut auf Instagram machen würde. Seit dem ist viel passiert. Ich bin der festen Überzeugung, dass die (sinnliche) Erfahrung und die persönliche Begegnung mit Kunst einer der wesentlichen Faktoren für einen Museumsbesuch ist. Trotzdem hat sich der Erlebnischarakter in den letzten Jahren gewandelt und die Ansprüche der BesucherInnen sind gewachsen. Mehr denn je sind Museen und Kultureinrichtungen gefordert aus der starken Konkurrenz mit anderen „Freizeiteinrichtungen“ den Blick potenzieller BesucherInnen pointierter zu lenken. Somit beginnt der #KultBlick eigentlich schon in der Außenwahrnehmung eines Museums.
Der erste Blick auf die Website, das Plakatmotiv und die Texte der Drucksachen können die Entscheidung für einen Museumsbesuch ganz klar unterstützen. Auch wir im Marta versuchen uns daher bei jedem Entwicklungsprozess eines Leitmotivs in den Besucher hineinzuversetzen, doch bekanntlich ist die Reduzierung des Ausstellungsinhalts auf ein einziges Motiv ein wahrer Balanceakt, den wir auch bei der aktuellen Ausstellung „Revolution in Rotgelbblau“ wieder erlebten. Ein weltbekanntes Werk auf dem Plakat, wie in diesem Fall der Rot-Blaue Stuhl von Gerrit Rietveld, macht aus Perspektive der Öffentlichkeitsarbeit durchaus Sinn.
Und trotzdem wird der Dialog mit zeitgenössischen KünstlerInnen erst bei näherer Auseinandersetzung mit dem Ausstellungsinhalt deutlich. Und genau an dieser Stelle ergeben sich die zahlreichen Möglichkeiten des Digitalen für Museen und andere Kultureinrichtungen. Die Präsenz auf einschlägigen Social Media-Kanälen trägt nicht nur zur Besucherbindung bei. Durch eine eigene Öffentlichkeitsarbeit mit Geschichten, die nicht in der Presseberichterstattung zu finden sind und die auch kein Plakatmotiv abbilden kann, werden Inhalte greifbarer und lebendig. Wir leben in einer Welt voller Möglichkeiten und Reize, die aber – besonders durch die starke Entwicklung im Digitalen – für Kulturinstitutionen unendliche Chancen bergen können.
Hinweis:
Das Archäologische Museum Hamburg hat in Kooperation mit Tanja Praske von Kultur-Museums-Talk zur Blogparade #Kultblick aufgerufen, der wir sehr gerne gefolgt sind. Hier bloggt Friederike Fast über ihren #KultBlick als Kuratorin.
8 Replies to “Der #KultBlick aus der Öffentlichkeitsarbeit”
Comments are closed.



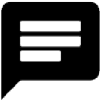
Liebe Daniela,
merci für deinen #KultBlick! 57 fantastische Beiträge gibt es heuer, einer fesselnder als der andere und jeder offenbart einen sehr persönlichen Zugang zur Kultur!
Der unbedarfte Blick wurde schon mehrfach angesprochen und trotzdem fügst du diesem eine neue Facette hinzu. Wichtig finde ich den Aspekt – das Museum muss etwas tun, um gegen die (Freizeit-)Konkurrenz anzukommen. Denn die ist da. Die Menschen müssen nicht ins Museum gehen. Man muss ihnen Anreize dazu geben und die können mitunter digital sein. Denn einmal besucht, ist der Museumsgänger weg, kann aber als digitaler Besucher zurückkommen, wenn es entsprechende Angebote gibt.
Schönes Wochenende!
Herzlich
Tanja
Liebe Tanja,
sehr gerne geschehen! Nach der trubeligen Zeit im Zuge der Ausstellungseröffnung von „Revolution in Rotgelbblau“ war es für mich sehr beeindruckend die Beiträge der vielen Mitblogger zu lesen. Es ist ja fantastisch, was alles zum #Kultblick zusammengetragen wurde und wie unterschiedlich die Themen stellenweise aufgegriffen wurden! Hier im Marta war die Blogparade ein schöner Anlass für Austausch und Diskussion.
Herzliche Grüße aus dem Marta,
Daniela