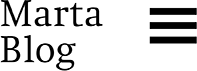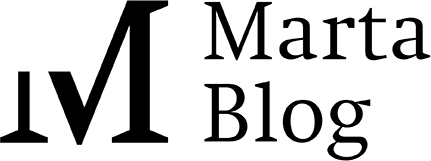Durch Raum und Materie – Gedanken, die sich beim Gehen durch „Glas und Beton“ verfestigt haben
Anke von Heyl geht es laut eigenen Angaben im Marta eigentlich immer so, dass das Zusammenspiel von Architektur und Ausstellung eine ganz besondere Wirkung auf sie hat: „Bislang hat mich hier noch jede Ausstellung schon nach dem Betreten gepackt.“ Auch beim Besuch von „Glas und Beton“ war das nicht anders.
Die Stimmung, die ich hier ruhig einmal als Euphorie beschreiben will, rührte nicht nur daher, dass die direkte Begegnung mit der Kunst nach der Zeit des Lockdowns wie ein Sommerregen nach einer langen Zeit der Dürre wirkte, sondern auch daher, dass ich zu dem Ausstellungsthema eine ganz eigene und besondere Verbindung habe. Zum einen bin ich bekennende Brutalistin. Ich liebe die Beton-Architektur der 60er Jahre und spüre dem dort eingesetzten Werkstoff schon lange nach. In der Ausstellung begegnete ich an verschiedenen Stellen zum Beispiel der brutalistischen Kirche Johannes XXIII., die zu meinen absoluten Lieblingsorten zählt. Sie befindet sich quasi vor meiner Haustür. Oft pilgere ich dorthin, um meine Hand auf die Wände zu legen und der Betonschalung aus rohen Baumstämmen nachzuspüren. Zum anderen habe ich mich schon während des Studiums mit den architektonischen Erfindungen von Bruno Taut beschäftigt und oft von seinem Glashaus geschwärmt, das einst in meiner Heimatstadt Köln gestanden hat. Abgesehen von dieser ganz persönlichen Verbindung funktioniert die Ausstellung für mich auf ganz unterschiedlichen Ebenen, denen ich hier nachspüren will.
Erlebnis im Raum
Durch die kongeniale Zusammenwirkung von Raum und Werken entsteht in „Glas und Beton“ ein einzigartiges Raumerlebnis. Ich habe Verbindungen nicht nur zwischen den einzelnen Ausstellungsobjekten, sondern auch über verschiedene Sichtachsen hinweg entdeckt, die mich teilweise magisch angezogen haben. Die herausfordernden Möglichkeiten, die sich im Marta durch den speziellen Charakter der Architektur ergeben, nutzen die Künstlerinnen und Künstler gerne für spannende Installationen vor Ort. Herr Gehry bringt Schwung in die Sache.
Daniela Friebel beispielsweise spielt mit dieser Idee der Sichtachsen und hat mich gleich hintersinnig auf eine falsche Fährte geführt. Als ich vor „Reflexion“ stand, war ich äußerst irritiert. Bei genauem Hinsehen meinte ich nämlich, in dem dunklen Bild eine Spiegelung des Ausstellungsraumes im Marta zu erkennen. Je länger ich draufgestarrt habe, desto mehr fühlte ich mich plötzlich wie Graf Dracula. Wider Erwarten habe ich mein Spiegelbild nicht gesehen. Was war da los?
Glas verspricht ja in vielen Fällen eine gute Durchsicht. Diese Erwartung wird aber im wahrsten Sinne des Wortes durchbrochen. Das ist auch passiert, als ich die Arbeit von Isa Melsheimer entdeckt habe, die die Künstlerin direkt in eine Wand des Ausstellungsraumes hineingesetzt hat. Wie schön die kristallinen Formen des Glasbruches da in der Lücke funkelten. Dahinter dann – roh und fast schon ein bisschen zu ehrlich (brutalistisch) die offen gelegte Verkleidung des nächsten Raumes.
Ich muss zugeben, auf die Arbeit von Lena Goedeke war ich besonders gespannt, denn ich habe einige Postings vom Marta verfolgt, die darauf neugierig gemacht haben. Und als ich hörte, dass sie die Enkeltochter von Heinz Buchmann ist, war ich natürlich besonders aufmerksam. Vor allem, weil sie in ihrer Arbeit auf den Grundriss der Rikus-Kirche Bezug genommen hat, die ihr Großvater mit dem Bildhauer gemeinsam erschaffen hat. Zombies heißen jene Versatzstücke oder Fragmente, die sie über die Ausstellungsräume im Marta verteilt hat. Diese bestehen aus losem Zement, der durch Druck in Form gebracht wurde. Sie würden zu Staub zerfallen, wenn man sie berührt, hab ich recht?
Beim Rundgang durch die Ausstellung ist mir wieder der Begriff des Gesamtkunstwerks in den Sinn gekommen, der mich immer schon begeistert hat. Die Romantik hat ihn erfunden und dieses Eintauchen in eine künstlerische Inszenierung zum Prinzip erhoben. Heute denken wir in diesem Zusammenhang auch an das Phänomen der Immersion in virtuelle Realitäten. Und ein Stück weit habe ich mich so auch in „Glas und Beton“ gefühlt – als wenn ich in eine andere Welt eintauchen würde.
Wenn man diesem Gedanken folgt, dann ist die Insel im Marta ein absoluter Höhepunkt! Adrien Tirtiaux hat sie als raumgreifende Installation in den letzten Ausstellungsteil gesetzt. Hier kann man Teil des Kunstwerks und seiner speziellen Geschichte sein. Nicht wundern, wenn man Tim und Struppi begegnen sollte!
Material erzählt Geschichten
Da man in der Ausstellung besonderen Oberflächen-Reizen ausgesetzt ist (ja, ich wollte überall anfassen, über Glas streichen oder rauen Beton spüren), funken permanent haptische Signale ans Hirn. Aber ich habe mich natürlich zurückgehalten. Die Idee, dieses Bedürfnis über eine interaktive Station einzulösen, an der man unter anderem selbst seinen Beton mischen kann, hat mir wirklich gut gefallen. Auch, dass die Installation von Tirtiaux nach dem Ausstellungsende bleiben und weitere Impulse für die Besucherinnen und Besucher bereit halten wird, finde ich grandios. Und deswegen war es auch ok, dass man gerade bei meinem Besuch in Herford dort Corona-bedingt nicht aktiv sein konnte. Das Storytelling rund um die Motivwelt der Insel hat mich auf jeden Fall auch schon auf eine schöne Reise mitgenommen!

Was mich bei der Begegnung mit Glas und Beton in den Kunstwerken am meisten fasziniert hat, ist die Art, wie sich Geschichten in Kunst materialisieren können. Den Künstlerinnen und Künstlern ist es gelungen, mich nicht nur unmittelbar und sofort über die Ästhetik des Materials zu erreichen. Sondern gleichzeitig auch in meinem Kopf den Transfer zu zahlreichen Ideengebäuden zu leisten. In denen bin ich gerne spazieren gegangen.
Der alchemistische Ansatz der Fertigung von Glas ist übrigens eine Sache, die in meinen Gedanken nachhaltige Schwingungen ausgelöst hat. Und dann begegnete ich der Arbeit von Louisa Clement. Da lagen erst mal nur schwarze Glasbrocken. Als ich die Geschichte dahinter erfahren habe, hat es mich allerdings sofort in eine ganz andere Welt gebeamt. Eine Welt, in der ein grausamer Krieg schwelt. Mit Giftgaseinsätzen. Eine Horrorvorstellung, die auch dann nicht verschwindet, als ich lerne, dass in diesen Glasbrocken das Sarin gefangen ist, das in Syrien beschlagnahmt wurde. Was ich nicht wusste, ist die Tatsache, dass Glas die unglaubliche Eigenschaft besitzt, hochgiftige Stoffe für immer an sich zu binden. Und zwar so, dass sie niemandem mehr schaden können. Ich konnte mich lange nicht von diesem Anblick lösen. Transformationsschnitt hat Clement ihre Arbeit betitelt – ein Begriff, über den ich noch nachsinnen muss.
Im Ausstellungkatalog hat Susanne Witzgall (cx centrum für interdisziplinäre studien an der Akademie der Bildenden Künste München) über die „Neue Materialität“ geschrieben. Ich bin überzeugt davon, dass es in Zeiten der Digitalität eine Neubewertung des Analogen bzw. des Materiellen gibt und man diesen zukünftig eine andere Aufmerksamkeit schenken wird. Die Ausstellung zeigt, dass Glas und Beton die damit verbundenen Erwartungen auf jeden Fall einlösen können. Die beiden Materialien scheinen auf den ersten Blick vollkommen unterschiedlich. Aber auf den zweiten Blick haben sie viele Gemeinsamkeiten. Eine davon ist die Verbindung mit dem Begriff der Utopie. Meine Begeisterung für die brutalistische Architektur rührt auch von der Tatsache her, dass sie auf der Vision einer offeneren und demokratischeren Gesellschaft aufbaut. Von den Glasarchitekturen wissen wir, dass sie zum Ideal einer transparenten Gesellschaft werden sollten – eine Vorstellung, die mich immer schon angesprochen hat.
Mit Glas und Beton auf dem Gedanken-Karussell
Während ich durch die Ausstellung gelaufen bin, haben mich diese Gedanken begleitet. Und wie eine Art virtueller Mentor ist vor meinem geistigen Auge auch ein legendäres Kunstwerk aufgetaucht. Marcel Duchamp hat mit seinem „Großen Glas“ das wohl komplexeste Gebilde von Assoziationen, Materialien und Zufällen geschaffen. Ein Meisterwerk, das ich bis heute nicht vollkommen verstanden habe. Aber vielleicht muss ich das auch nicht. In „Glas und Beton“ wird es mir natürlich mit auf den Weg gegeben.
Überraschenderweise habe ich bei der Arbeit von Vincent Ganivet unwillkürlich an Duchamp gedacht, auch wenn die Konstruktion aus einzelnen Betonbausteinen natürlich ganz anders ist. Aber ich habe es als radikales Gebilde zwischen Spannung und Gleichgewicht wahrgenommen. Auch wenn es nach einer Momentaufnahme aussieht – das Werk ist das Ergebnis einer ausgeklügelten Konstruktion. Die in mir aber auch einen Moment der Ungewissheit hervorgerufen hat. Gleichzeitig ist mir aber alles Mögliche im Kopf herumgeschwirrt. Wie konnten sie damals nur die mittelalterlichen Kathedralen bauen? Wird vielleicht gleich ein unglaubliches Monster zum Leben erwachen? Was macht die Kunst mit mir? Es war eine wirklich interessante Zwiesprache, die da im Marta zwischen mir und der Kunst stattgefunden hat.
Am Ende meiner Betrachtung möchte ich noch einmal zum Anfang zurückkehren. Und zwar zum Eingangsbereich der Ausstellung. Mittlerweile ist es eine schöne Marta-Tradition, diesen für eine Einführung in das zu verhandelnde Thema zu nutzen. Ich habe an dieser Stelle schon diverse Turn- oder Schreibübungen hingelegt und schätze diese Vorbereitung auf den nachfolgenden Rundgang. Diesmal erwartete mich ein überdimensionales Cluster, eine besondere Mind-Map. Geschichtliche Hintergründe und inhaltliche Bezüge werden nachvollziehbar aufgefächert und fassen zusammen, was alles im Innersten zusammenhält. Man kann von Herstellungsprozessen über stilbildende Vorbilder zu inhaltlichen Schwerpunkten wandern und erlebt eine gut funktionierende Visualisierung des Ausstellungsthemas.

Und im Eingang bin ich auch der Arbeit von Stephan Huber begegnet. „Arbeiten im Reichtum“ ist ein perfekt erzähltes Dramolett. Es verbindet das Rohe des Baustellencharakters von Beton mit dem Prunkvollen, das nur Kronleuchter auf diese besondere Art ausstrahlen können. Durch den Titel des Kunstwerks wird die Installation zur Mikro-Erzählung gesellschaftlicher Phänomene, denen ich auch in der Ausstellung begegnet bin. Im Katalog ist vom Sichtbarmachen des Unsichtbaren die Rede – das deckt sich mit der Erfahrung, die ich bei meinem Besuch mit der Kunst machen konnte. Und weil mir die Zitate im Ausstellungskatalog besondere Freude bereitet haben, picke ich abschließend einen Lieblingsspruch heraus (von der Punkband S.Y.P.H. aus dem Jahr 1980), der ein prima Fazit ist:
Zurück zum Beton
Zurück zum Beton
Zurück zur U-Bahn
Zurück zum Beton
Da ist der Mensch noch Mensch
da gibt’s noch Liebe und Glück
Zurück zum Beton
Zurück zum Beton
Über die Autorin:
Anke von Heyl M.A. ist Kunsthistorikerin und war u.a. Redaktionsleiterin (teNeues Verlag) und wissenschaftliche Mitarbeiterin (Museumsdienst Köln). Seit 2002 arbeitet sie freiberuflich für Museen und Kultureinrichtungen deutschlandweit und betreibt einen erfolgreichen Kulturblog. Sie hat sich auf die Besucherorientierung spezialisiert und ist Social-Media-Expertin. Ihre Schwerpunkte sind partizipative Formate und digitale Wege ins Museum. Anke von Heyl ist derzeit als Beraterin für Kulturentwicklungsplanungen tätig. Zusammen mit Wibke Ladwig und Ute Vogel bildet sie das Kulturkollektiv „Die Herbergsmütter“.