Ist Architektur bereit für die Zukunft?
Bei Stadt + Vision stellte der Architekt Jan Musikowski das Berliner „Futurium“ vor. Dabei ging er auch der Frage nach der Zukunftsfähigkeit von Baukunst auf den Grund. Nutzbar und effizient, zugleich innovativ, nachhaltig und von ästhetischer Qualität – Kann Architektur da mithalten?
„Der gegenwärtigen Architektur fällt es zunehmend schwerer, sich auf die zukünftigen Veränderungen einzulassen. Zu komplex erscheinen die Abhängigkeiten und zu spezifisch die Strukturen, als dass sie mit der Leichtfüßigkeit technischer Entwicklungen Schritt halten könnte“, so Jan Musikowski in seinem Impulsvortrag „Jedes Haus ist ein Zukunftsgefäß“ am 25. September 2019 im Marta. Sein Büro Richter Musikowski (Berlin) hatte den Bau für das „Futurium – Haus der Zukunft“ (2015–2017) verantwortet. Aus diesem Grund bezeichnet Musikowski das Bauvorhaben dieses „Zentrums für Zukunftsgestaltung“, rückblickend als „durchaus paradox. Aber es ist auch als Chance zu verstehen, um Antworten auf Fragen zu finden, die uns im Hinblick auf die Zukunft unserer Städte ohnehin bald erwarten.“
Keine Angst vor Ideen!
Bemerkenswert fand ich, dass das Futurium das erste gemeinsame Projekt von Jan Musikowski und Christoph Richter ist. Aufgrund dessen hatten sie 2012 ihr Architekturbüro in Berlin erst gegründet. Damals hatten sie die Kommission des anonymen Wettbewerbs mit ihren innovativen Ideen – anstatt mit einem bekannten Namen – überzeugen können. Inspiration für das Gebäude lieferten ihnen unter anderem Science-Fiction-Filme, aber auch Vorbilder aus der Natur. „Man muss keine Angst davor haben, etwas vorzuschlagen, von dem man noch nicht weiß, wie man es umsetzen kann. Es gibt viele spannende Baumaterialen, um kreative Wege zu entwickeln.“
Für das Gebäude bzw. die Fassade hatten sich die Architekten beispielsweise etwas Festes und zugleich Vergängliches vorgestellt. Es sollte wie eine Wolke, aber auch wie ein Spaceshuttle sein. „Beim Futurium fangen die reflektierenden Kacheln aus robustem Gussglas und Metall das Licht effektvoll ein“, so Musikowski. Sie erzeugen schließlich ein sich mit dem Lichteinfall beständig änderndes Wolkenbild.
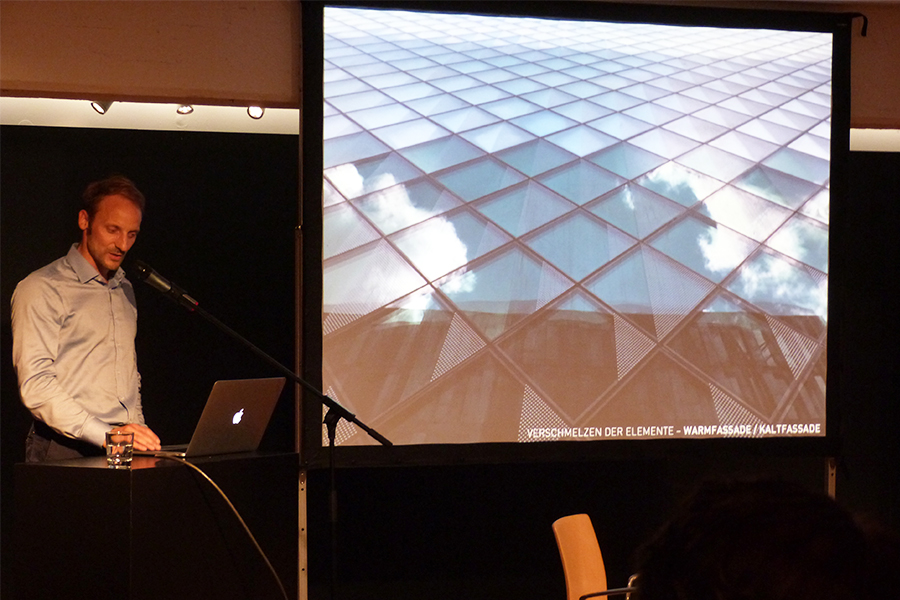
Was steckt in einem Taschenwärmer?
Überraschend anschaulich klang auch die ausschlaggebende Idee bei ihren Überlegungen für das Energiekonzept. Das Gebäude sollte ressourcensparend, mit regenerativen Energien und durch Speicherung von Sonnenenergie betrieben werden. Ein einfacher Taschenwärmer, der als Phasenwechselspeicher (durch den Wechsel von kristallinem/festem zu flüssigem Paraffin) Wärme erzeugt, brachte die Architekten darauf, Paraffinspeichertanks zu entwickeln. Dieses Energieprinzip sollte explizit auch für das Publikum sichtbar sein, was damit an die Ausstellungsinhalte anknüpft: Ausgehend von der Kernfrage „Wie wollen wir in Zukunft leben“ werden im Futurium Zukunftsentwürfe, Technologien und Lebensformen des Menschen im Zusammenspiel mit Technik und Natur vermittelt.
Die Energiesituation betreffend können die Besucher*innen nun vom „Skywalk“ auf dem Dach aus die Speichertanks sehen und anhand der jeweils angezeigten Farbe den aktuellen Energiebedarf nachvollziehen. Darüber hinaus sorgen ebenso Kollektorfelder für Photovoltaik auf dem Dach für den Standard eines Niedrigst-Energiehauses.
Weitere Details und Hintergründe (nicht nur) zu diesem Projekt hat Jan Musikowski im folgenden Interview verraten:
Das im September 2019 eröffnete Futurium verspricht Visionäres: Was ist aus gestalterischer, technischer, stadtplanerischer Sicht sowie auch die Nachhaltigkeit betreffend am Gebäude besonders zukunftsorientiert? Und wie haben Sie dem entgegengewirkt, dass es in 10 Jahren nicht überholt erscheint?
Aus stadtplanerischer Sicht war uns zunächst einmal wichtig, dass der Standort im Kontext der monofunktionalen Bürobauten in der unmittelbaren Umgebung zu einem lebendigen Ort mit vielschichtigen Aufenthaltsqualitäten gedeihen kann. Freiflächen, Sitzmöglichkeiten, Grünpflanzungen und öffentlich begehbare Dächer sind einfach zu realisierende Maßnahmen, aber viel zu oft werden sie aus Effizienzgründen eingespart. Für die Zukunft unseres städtischen Lebensraums sind sie jedoch elementar.
In Bezug auf die Nachhaltigkeit haben wir mit dem Futurium das BNB-Gold-Zertifikat und die derzeit höchste Bewertung unter allen Bundesbauten erreicht. Wer sich mit Nachhaltigkeit genauer auseinandersetzt, weiß, dass hierfür ein komplexer Anforderungskatalog von der integralen Planung, über energetische Kreislaufprozesse bis hin zur Produktüberwachung eingehalten werden muss. Gutes Design und Nachhaltigkeit müssen sich aber keineswegs widersprechen.
In Bezug auf die Fassade haben wir eher auf robuste und austauschbare Materialen gesetzt, die mit den natürlichen Lichteffekten spielen anstatt der Verlockung einer LED-Fassade zu erliegen und damit möglicherweise in ein paar Jahren schon wieder „out“ zu sein. Für uns liegt die größte Zukunft des Hauses darin, dass es möglichst lange als „Zukunftsgefäß“ benutzt werden kann.
Im Innern haben wir gemeinsam mit den Ingenieuren einige neue zukunftsweisende Technologien entwickelt. So reagiert zum Beispiel die LED-Beleuchtung im Erdgeschoss interaktiv auf die Besucher*innen und kann damit nicht nur interessante visuelle Effekte erzeugen sondern auch Energie sparen.
Was waren Inspirationsquellen für den Bau des Futuriums oder einzelner Bereiche bzw. Funktionen?
Wir haben uns zum Beispiel mit Objekten der Flug-, Schiff- und Raumfahrt auseinandergesetzt, weil uns dort die unterschiedlichen Raumgefäße und Materialien faszinierten. Auch Filmsets und andere Zukunftsvisionen haben uns diesbezüglich inspiriert. Selbst in der Natur fanden wir Strukturen und Oberflächen, glitzernde Schuppenhäute oder Kristallstrukturen, die uns direkt oder indirekt beeinflussten. Daneben haben wir uns auch realisierte Bauwerke angeschaut und uns dort Anregungen geholt.
Was ist aus Ihrer Sicht gute Architektur?
Aus unserer Sicht ist Architektur wirklich gut, wenn sie es neben der Erfüllung aller funktionalen, gestalterischen und stadträumlichen Aspekte schafft, uns emotional zu berühren.
Welches Gebäude hätten Sie gerne selbst entworfen oder welches Ihrer Projekte würden Sie als besonders überzeugend bezeichnen?
Das Futurium ist unser erstes Projekt und für uns wirklich ein Glücksfall. Wir können es selbst kaum glauben, dass wir unter 163 Einreichungen im Realisierungswettbewerb als Sieger hervorgegangen sind und es danach auch bauen durften. Persönlich haben wir viel Herzblut hineingesteckt und deshalb freut es uns auch, dass es viel positives Feedback gibt. Wenn wir es uns hätten wünschen dürfen, dann hätten wir auch gern mit einem kleineren Objekt angefangen.
Wenn Sie vor ca. 20 Jahren das Marta Herford hätten planen können, wie würde es aussehen?
Wahrscheinlich wäre unsere Formensprache nicht ganz so voluminös und bewegt ausgefallen. In der Metaphorik hätten wir also eher das Chamäleon als den Pfau an dieser Stelle gewählt. Wie schön, dass Frank Gehry anderer Auffassung war und Herford ein Haus mit berührender Strahlkraft beschert hat.



