Pamphlet über die Augenhöhe
Unsere Blogparade zur #BesucherMacht ist zu Ende und nun soll Bilanz gezogen werden. Herausgekommen ist ein ganz und gar nicht abschließender Zwischenruf zum Leben in der Blogger-Blase.
Als ich mich dazu bereit erklärte, zum Abschluss unserer ersten Blogparade zur #Besuchermacht resümierend „einen ganz persönlichen Blick“ auf das Thema zu werfen, war ich weit davon entfernt zu ahnen, auf was ich mich da einlasse. Und damit gar nicht erst irgendwelche Illusionen entstehen, dass so ein „Direktorenkommentar“ gar etwas Besonderes wäre, ließ Michael Bauer als eine der ersten Wortmeldungen gleich den Oberlehrer-Hammer niedersausen. Danke, das saß dann schon mal!
Aber trotz über 30 Jahre Schreiben geht es mir nicht anders als es Peter Soemers in einem Kommentar so treffend sagte: „Das Veröffentlichen eines Blogposts fühlt sich meistens an wie eine Schwangerschaft – und dann endlich die Geburt.“ Vielleicht ist die Geburt nach so vielen Kindern ja tatsächlich komplikationsloser als in den Anfangstagen, aber die Schwangerschaften werden trotzdem nicht kürzer oder weniger anstrengend. In diesem Fall kam nach dem Verfolgen der ersten Tweets, Blogposts und Kommentare neben der Frage, WAS ich da eigentlich am Ende resümieren soll, die Zweifel, WIE ich das alles im Blick behalten kann. Bevor ich also loslege gleich zu Beginn schon einmal einen Riesendank an meine Mitarbeiterin Tabea Mernberger, die die gesamte Blogparade nicht nur großartig begleitet, sondern für mich auch fantastisch aufbereitet hat. Denn – das gebe ich hier gerne zu – trotz aller digitaler Strategien und gepixeltem Lesen, ich habe mir den beeindruckenden Materialstapel höchst analog auf den Schreibtisch gelegt, mit Notizen, Unterstreichungen und Anmerkungen versehen, um irgendwie eine Bresche durch den Verlauf zu schlagen (zum Ausdruck von Blogposts am Ende noch ein PS).
Vorrede
Also das Resümee? Es war ein wenig wie allein mit einer zu großen Tüte Gummibärchen: Der Geschmack eines jeden Einzelnen ist super, aber in der Gesamtheit irgendwie zu viel und zu süß. Da kann ich nicht einfach noch eine Tüte aufmachen, will ich auch gar nicht, sondern jetzt werden mal ein paar Oliven angeboten!
EINS Nachdem ich den Start eines Marta-Blogs vor allem mit dem Argument vorangetrieben habe, dass wir in Zukunft vermehrt unsere eigene Öffentlichkeit schaffen müssen, da die ehrwürdigen „alten“ Kanäle zunehmend verstopfen oder versiegen, frage ich mich gerade, ob wir nun nicht auch Teil eines Zuviels an Contentproduktion sind. Diese Blogparade hatte eine großartige Resonanz, viele haben engagiert und pointiert mitgemacht, aber liest man das alles in einem Rutsch, dann ist da auch ganz viel Wiederholung, Schmeichelei, Worthülse und Ungenauigkeit. Und im Netz bleibt ja alles erhalten. Wer oder was aber leitet mich später mal durch die Vielzahl von Posts und Kommentare zum Wesentlichen? Könnte man doch nach einer Blogparade einfach eine fundierte Zusammenfassung schreiben und dann alles wieder löschen, ähnlich wie der Reader zu einer Tagung. Doch das Vergessen ist in der digitalen Welt nach wie vor ein schwieriges Thema. Apropos Zusammenfassung: So, wie „Stichwort Partizipation“ von Anke von Heyl und vor allem auch „Partizipation: Vom Museumsbesucher zum Macher? von Peter Soemers (Gastautor auf Tanja Praskes Blog) die Diskussion kondensiert haben, so hätte dieses Statement hier auch aussehen können (auch wenn ich nicht in jedem Punkt gleicher Meinung bin), diesen Part brauche ich also nicht mehr zu übernehmen.
ZWEI Zurück zu den Gummibärchen: Ich kann plötzlich „Partizipation“ nicht mehr lesen oder hören, und nicht umsonst reiben sich durchaus auch einige der schreibenden VermittlerInnen schon länger an dem Begriff: zu viel, zu ungenau, zu unterschiedlich verwendet, ein allgegenwärtiges Schlagwort, das einem fast zwangsläufig irgendwann um die Ohren fliegt. Auch wir als Museum werden wohl weiterhin damit hantieren und in der Sache ist das ja auch alles andere als schlecht, aber bis zum Ende des Jahres reicht es mir erst mal. Warum? Dazu im Folgenden, wenn das Pamphlet beginnt.
DREI #BesucherMacht – Da zuckten aber einige ganz gehörig zusammen oder taten sich, wie Tanja Praske schrieb, „mit dem Hashtag schwer“. Warum? Während über das Museum, seine kulturelle Deutungshoheit und Definitionsmacht gerne und abstrakt diskutiert wird, ist es dann doch offensichtlich etwas ungehörig, wenn eine solche Institution den Macht-Begriff selbst in den Ring wirft. Da wird sich erst mal ganz ironiefrei über Machtergreifung und Machtkämpfe abgearbeitet, bevor man über die Starwars-Assoziation auf den Gedanken kommt, dass es ja auch spielerisch gemeint sein könnte: Vielleicht hätten wir den Hashtag doch lieber #BesucherMachtAusstellung, oder kryptisch kurz und unverfänglich #BmA nennen sollen? Dass Sarah Niesel dann das Wortspiel explizit erklären und Michael Kröger nochmal die Leichtigkeit thematisieren mussten, hat mich bei der vielgeliebten Ironie, die man den Institutionen gerne entgegenbringt, doch etwas gewundert.
VIER Es ist immer wieder schön zu lesen, wie respektvoll und anerkennend die Blogger-Szene zumindest in diesem Segment miteinander umgeht. Man lobt, dankt, anerkennt und kritisiert wohl dosiert und gut abwägend, ermutigend und motivierend. Der Zuckerschock: Nach der mehrstündigen Lektüre von „ich mag Deine Kommentare so sehr“, „danke für Deine hilfreichen Argumente“, „toll, wie Du das wieder formuliert hast“, „merci für diesen wichtigen Einwurf“, „ich lese Deinen Blog so gerne“ kann ich nicht mehr. Gibt’s auch jemand, der höflich auf den Tisch haut, respektvoll klares Kontra gibt und leidenschaftlich widerspricht. Oder haben wir uns alle immer ganz lieb, weil Kultur ja so ein bedrohtes Pflänzchen ist?
FÜNF Dann übernehme ich das eben, polemisch, überzogen und voller Lust auf Streitbarkeit …
Pamphlet
Die vielzitierte „Kommunikation auf Augenhöhe“ ist eine Chimäre, es gibt sie schlichtweg nicht. Es ist eine dieser Augen und Ohren verkleisternden Floskeln, die die Differenz wegzureden versuchen und in erster Linie zur Verschleierung eines Arroganzvorwurfs dienen. Gemeint ist: Das Museum, der Ausstellungsmacher, die Kunst sitzen auf einem hohen Ross, sprechen in einer bewusst schwer verständlichen Sprache, blicken auf das Gegenüber herab und gönnen ihm höchstens eine etwas mitleidig vorgetragene Erklärung. Deshalb sollen die genannten Akteure gefälligst etwas einfacher agieren, gestalten und argumentieren, sodass man ohne viel Arbeit, Vorkenntnisse und Einsatz mitmachen kann.
„Auf Augenhöhe“ heißt, es beugt sich immer einer zum anderen herunter. Und damit sind wir mitten im Thema Hierarchien, Macht, Kräfteverhältnisse. Wenn wir uns also unbedingt beugen wollen oder sollen, bleibt die Frage, wem: den Verhältnissen, den Wünschen einzelner oder der Mehrheit. Und wer beugt sich dann zu wem? Dieses Verhältnis – in unserem Falle zwischen Institution und Nutzern/Besucherinnen – kehrt sich nämlich durchaus auch um.
[[ Einschub: Vielleicht täusche ich mich ja, aber ich höre z. B. in den Einlassungen des engagierten Wolfgang Ullrich („Museen und die Sozialen Medien“) bisweilen auch so ein leichtes akademisches Naserümpfen durch, wenn es um die Niederungen der institutionellen Alltagspraxis geht? (Ich würde so gerne mal den Kollegen oder die Kollegin kennenlernen, der/die seine Besucherzahlen „tagesaktuell auswendig kennt“ und „seinen Erfolg wesentlich darüber definiert“. Sind das jene Ausstellungsmacher, die – wie es sich Michael Bauer vorstellt – „besser an Wünschen entlang kuratieren“?) Und wie verläuft eigentlich die hierarchische Linie, wenn Angelika Schoder einen Satz wie diesen abfeuert: „wieder ein spannender Ansatz eines Museums, der nicht weit genug gedacht wurde“; ein wenig Kopftätscheln für die armen Museumslemminge, die noch so viel lernen müssen … /EndeEinschub ]]
Was ist die „Augenhöhe“ in einem Museum (und für diese Institutionsform könnte man im Folgenden auch noch mehrere andere einsetzen), wo so viele Menschen mit höchst unterschiedlichen Interessen, Fähigkeiten, Bereitschaften und Hintergründen zusammenkommen? Welche Diskussion hat jemals damit begonnen, dass alle größeren Menschen in die Knie gingen, damit vor dem ersten Wort alle die gleiche Kopfhöhe aufweisen? Nein, es lebe die höchst unterschiedliche Augenhöhe, denn damit sehen wir deutlich mehr!
Zum Beispiel, dass wir in der Vergangenheit während des großen Museumsbooms und dem fröhlichen Fest der Großausstellungen im Rahmen der kulturellen Bildung fast eine ganze Generation vergessen, ja verloren haben. Sie sitzt jetzt in den politischen Ämtern und fragt danach, ob wir Museen überhaupt brauchen, warum sie nicht gewinnbringend betrieben werden, welchen Mehrwert Kunst eigentlich hat und wie man das „tote Kapital“ einer Sammlung in einen Geldfluss verwandeln kann. Hier hat Vermittlung in diesen Tagen noch immens viel zu tun, und zwar weiß Gott nicht auf Augenhöhe!
Die großen Unterschiede in unserer Gesellschaft überbrücken wir nicht, indem wir uns im Bücken üben, gar buckeln, sondern allein über Bildung, Bildung, Bildung! Wann endlich wird in breitem Rahmen begriffen, dass Kultur, Soziales und Bildungswesen keine gegeneinander auszuspielenden Verantwortungsbereiche sind, sondern zusammengehören? Dass für die Herausforderungen des offenen Ganztags, der Wissensvermittlung, der Flüchtlingsströme die Museen und Kulturinitiativen ein Teil der Lösung sind. Und dass dies nur geschehen kann, wenn diese Institutionen nun nicht zu großen Sozialeinrichtungen umgebaut werden, sondern endlich wieder neben all dem Vermittlungsengagement auch ihre ureigenen Aufgaben wahrnehmen können: ein kulturelles Gedächtnis lebendig zu erhalten, es zu befragen, zu diskutieren und zu erweitern. Das ist keine Polemik, nur eine etwas verkürzte Formulierung: In Krisenzeiten sollten als erstes die Kulturetats verdoppelt werden.
[[ Einschub2: Und doch, ich bin es leid, immer aus dem Mangel heraus zu argumentieren; Ressourcen, Gelder, Motivationen, alles das können Faktoren sein, die zu Entscheidungen führen, und die auch den Verlauf dieser Blogparade und der #Paarweise-Aktion bestimmt haben. Aber es waren eben auch Entscheidungen, manche gut abgewogen, einige aus der Not heraus gefällt, andere nicht einmal bewusst. Wichtig ist vielmehr die Haltung, die hinter dem Tun steht, und wenn ich mir hier noch einmal den Blick auf das hiesige Team erlauben darf: Die stimmt und macht mich sehr froh! /EndeEinschub2 ]]
Das Museum ist ein Schutzraum, ein Ort der Begegnung UND der Besinnung, laut und leise zugleich, leidenschaftlich, subjektiv, engagiert, Augen und Geist weit geöffnet. Das Museum ist ein Experimentierfeld, eine Versuchsanordnung über unsere Vergangenheit und eine mögliche Zukunft, ein Haus für Vorschläge und Angebote, wo Neues gedacht, Unkonventionelles erprobt und auch Fehler gemacht werden dürfen. Hier trifft man auf alle möglichen Augenhöhen, in den Wolken und am Boden, mit gesenktem Blick und in imperialer Pose, nach innen gerichtet und funkensprühend – und die Dialoge werden gerade deshalb so feurig, weil sie nicht auf dieser vereinheitlichenden „Augenhöhe“ stattfinden.
Vielleicht also sollten wir weniger die Zentimeter der Blickebene verhandeln als vielmehr das, was wir auf unseren unterschiedlichen Kopfhöhen sehen. Denn: Das Museum wird nur dann eine Überlebenschance haben, wenn es weiterhin eine Zumutung bleibt, herausfordernd, in Frage stellend, verstörend. Verehrung, Anbetung und Affirmation waren schon immer eine Einbahnstraße, und wenn wir das Museum so frech gestimmt verlassen, wie uns einige Werke der Kunst bisweilen gegenübertreten, dann ist ein wichtiger Schritt getan.
Postskriptum
PS 1: Jetzt komme ich mal wieder etwas runter im Emphase- und Erregungslevel. Die #BesucherMacht-Blogparade war eine sehr anregende und lebendige Diskussion. Ich danke allen TeilnehmerInnen von Herzen für die viele Mühe und Aufmerksamkeit, die all das gekostet hat (vor allem auch den noch nicht zitierten BlogerInnen Michelle van der Veen, Technoseum, historisches museum frankfurt und Alexandra Pfeffer sowie den zahlreichen KommentatorInnen, die oft mit kompetentem kunsthistorischen [[ nachträgliche Ergänzung: pädagogischen oder Marketing-]] Hintergrund schreiben). Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass in der Blogger-Szene etwas Grandioses geschieht, das wir gerade in der „konventionellen“ Medienszene zu verlieren drohen: eine lebendige Debattenkultur. Lasst uns gemeinsam weitermachen! Und bleiben wir freundlich zueinander – die Welt ist unfreundlich genug.
PS 2: Könnte man die digitale und die analoge Welt nicht auch dadurch noch etwas mehr miteinander in Verbindung bringen, dass man nicht trotz, sondern wegen eines wachen Umweltbewusstseins die Druckfunktion eines Blogs im Blick behält? Ich würde mir ein ganz schlichtes, papiersparendes CSS wünschen, das auf jedem guten Blog hinter einem leicht aufzufindenden, vor allem vorhandenen Druck-Button liegt. So manch ein Text wäre diesen Aufwand mehr als wert!
23 Replies to “Pamphlet über die Augenhöhe”
Comments are closed.



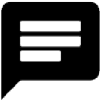
Lieber Herr Nachtigäller,
ich bin ein Fan! Sorry, dass klingt schon wieder so nach Gesülze (es gibt übrigens aus meiner Wahrnehmung auch den umgekehrten Fall, dass man gerne einen Rant verfasst, um die eigene Relevanz zu erhöhen – gut, lassen wir das. Ich weiß genau, was Sie meinen. Und leere Worthülsen mag niemand. Wertschätzung schon!!). Nein ehrlich, Sie haben genau das Richtige getan. Nämlich ehrlich und authentisch geantwortet!
Lustigerweise habe ich gerade heute länger über die Problematik nachgedacht, dass es für Museen eben doch nicht so einfach ist, zu experimentieren und sich ständig hinter die Kulissen blicken zu lassen. Denn, auch wenn das permanent eingefordert wird, so kommt auf der anderen Seite ein irrsinniges Anspruchsdenken daher. Und das Museum kriegt sofort eine Klatsche, wenn nicht alles perfekt und wasserdicht ist. Da wird es dann schwierig mit dem Rumprobieren.
Die Ressourcenfrage erzeugt einen gewissen Leidensdruck. Und hier könnte ein berühmtes Fußballzitat vielleicht auch die Situation gut beschreiben: „Wichtig is auf’m Platz“. Das wird auch gerne bei blumigen Konzepten für Social Media vergessen, das „auf’m Platz“. Denn man muss die ganze Theorie ja auch umsetzen. Und zwar nicht als einzelnen Leuchtturm, sondern ständig und immer wieder zu jeder Ausstellung neu!
Die Haltung ist jedenfalls das Wichtigste! Wenn die stimmt, dann kann man jedesmal neu gucken, welchen Output man hinbekommt. Aber die Haltung wird man immer bemerken. Meine ich zumindest. Und die spüre ich bei Ihnen auch in diesen deutlichen Worten, die auch eine gewisse Kritik in die Community zurückgeben. Finde ich gut!
Sie haben zugehört! Darauf kommt es an!!! Ich freue mich, weiter mit dem Marta und mit Ihnen im Dialog zu bleiben!
Herzliche Grüße
Anke von Heyl
P.S. Ich habe auch über Ihr Argument zum Ausdrucken von Blogbeiträgen nachgedacht! Kann ich auch zum Teil nachvollziehen. Mir geht es aber darum, dass man sich im digitalen Raum aufhält und die Kommunikation dort sucht. Sie tun das. Es gibt aber auch diejenigen, die dem Digitalen nicht näher kommen wollen. Da finde ich das mit dem Ausdrucken problematisch!! Denn das gehört ja zu einem Blog mit dazu. Dass man es als digitalen Raum sieht, den man auch betreten sollte.
Liebe Anke von Heyl,
danke für die Blumen! Und ich gebe auch gerne ein paar zurück: Gestern habe ich mir wegen Ihnen und Herrn Ullrich das gesamte 113 Min.-Video der Karlsruher Podiumsdiskussion angesehen (allerdings blieb der Diskussionsverlauf dann doch etwas hinter den – zugegebenermaßen hochgesteckten – Erwartungen zurück, das lag aber definitiv nicht an Ihnen!). Und bei der Kulturtussi schaue ich regelmäßig vorbei …
In der Tat war das noch ein Stichwort auf meiner Liste, das ich dann aber nicht mehr abgehandelt habe: Wenn Aktivitäten von Museen in den sozialen Medien kritisiert werden, dann fallen schnell Begriffe wie Kommunikationsstrategie, durchstrukturiert, verzahnt und vernetzt. Im Grunde sind das Vokabeln aus dem Agenturleben, nur dass das dann ja auch (meiner Meinung nach zu Recht) ganz böse ist, wenn hinter bestimmten Kulturkampagnen eine Marketingagentur steckt. Insofern: Wir diskutieren hier häufig darüber, wie gut durchdacht, geschickt positioniert, dem Publikum entgegenkommend kommuniziert wird, aber alle diese Aktivitäten haben immer wieder auch ihre kleinen Macken. Doch wir begehen dann lieber ein paar Fehler und Versäumnisse (von denen wir oft gleich zu Beginn schon wissen), als im Gewand anderer perfekt lackiert rüberzukommen.
Da ich, obgleich es unter den Kollegen ja einen gewissen Schick besitzt, nach wie vor nichts mit Fußball anfangen kann, kannte ich besagte Redensart noch nicht und werde sie mir – mit etwas schwererem Dortmunder Zungenschlag – unbedingt merken: Wichtich is aum Platz! Alles andere, was Sie anmerken, kann ich nur freudig zur Kenntnis nehmen und umgehend ans Team weiterreichen. Vielen Dank!
Mit besten Grüßen
Roland Nachtigäller
P.S. Und irgendwann schaffen wir es auch noch, Sie und einige Weitere aus der engeren Bloggergemeinde mal hierher nach Herford zu holen. Mal sehen, was uns dazu noch so einfällt …
Hach, lieber Herr Nachtigäller,
wie wunderbar und erffrischend der Post doch ist zur Blogparade #BesucherMacht – bin ich zu flauschig, mag sein, aber ich bevorzuge konstruktive Diskussionen und da passiert in der Kulturszene gerade einiges. Wenn wir es schafften, diesen Elan über die Gattungen hinein zu tragen, einen tatsächlich Diskurs über die Aufgaben eines Museums zu führen und zwar mit denen, die Museen eher meiden, dann wäre es richtig.
Richtig ist aber, dass Sie schon einmal sehr selbstironisch reflektieren. Ihre Stellungsnahme mit Haltung und Mangeldenken unterschreibe ich sofort, ebena auch aus leidiger Erfahrung: Kein Geld, keine Strukturen, kein Verständnis für die Kulturvermittlung, digital wie analog. Wo gibt es das denn wirklich, dass die Kunstvermittler in die Genese einer Ausstellung wirklich eingebunden sind? Ich sehe vielerorts Freelancer, die ihr Ding in Absprache machen. Ein ganzheitliches Konzept fehlt mir da. Und ja, es muss ein Umdenken her: Fokus auf das gesellschaftliche Miteinander über Bildung. Gäbe es dann weniger #ParisAttack, Parallelgesellschaften, mislungene Integration? Wo ist die Kultur der Offenheit? Beim Geld hört sie auf.
Ich kenne nicht wirklich ihr Vermittlungsprogramm hinsichtlich von Flüchtlingen, Integrationsleistung und Co. Sehe aber wie Sie, dass Museen hier viel bewegen könnten, wenn sie nicht schon bereits sehr früh die zukünftige Generation verlören – die KInder. Sie müssen ja keinen Eintritt zahlen, also, eine vernachlässigbare Zielgruppe (stopp, ich weiß, ich bin hier polemisch, ist nicht überall so und es gibt auch feine Programme von Museen). Aber irgendwann sind die Kinder weg, und zwar als Jugendliche. Ein Museumsbesuch lockt sie wirklich nicht von ihren Devices weg, es sei denn, man bietet ihnen ihre Devices unter anderer Fragestellung an – et voilà, schon sind wir wieder bei Kulturvermittlung 2.0/3.0/4.0 und co.
Ich hielt mich bei Ihrer Blogparade raus. Michael Bauer hatte ja schon zu Beginn geunkt, dass jetzt wieder die „Professionellen“ sich dem Thema widmen. Peter Soemers schrieb dafür, wie auch die anderen, einen in meinen Augen sehr erhellenden Blogposts (ich flausche mal wieder ein bisschen, weil ich es mag).
Kultur berührt. Das zeigte auch meine Blogparade #KultDef, die ich noch nicht zu Gänze ausgewertet habe. Wenn man sich die 74 Posts dazu antut, dann dürfte da ganz viel Anregendes für Museen, für Kulturinstitutionen drinstecken. Leider diskutierten sie nicht mit, außer das Archäologische Museum Hamburg. Warum eigentlich? Ist es nicht auch ihr ureigenstes Thema? Haben sie nichts zu sagen? Oder sind wir hier wieder beim Mangeldenken?
Also, merci für dieses Fazit zu #BesucherMacht – ich musste zuerst schon an Starwars denken 😉
Weiter so!
Beste Grüße
Tanja Praske
Liebe Frau Praske,
ich muss gestehen, ich hatte mit diesen positiven Reaktionen nicht unbedingt gerechnet, konnte ich doch noch nicht richtig einschätzen, wie leicht sich wer auch auf die Füße getreten fühlt. Umso mehr freut es mich, dass hier so schnell und dann auch noch so umfassend reagiert wird. Vielen Dank auch Ihnen dafür!
Und wenn ich mal ganz pragmatisch auf Ihre kleine Kinder-Polemik antworte: Sie zahlen zwar keinen Eintritt, heben aber enorm die Besucherfrequenz! Und im Ernst – ich bin da völlig Ihrer Meinung und hier in Herford gelingt uns das dank mehrerer Kooperationsverträge mit Schulen und enger Zusammenarbeit mit Kindergärten und KiTas sowie dem Modellprojekt „Kulturscouts“ sehr gut: Wenn die Kleinsten das Museum als einen Ort ihres (Schul)Alltags erleben, dann haben wir sie als Erwachsene schon halb gewonnen. Und ‚Ort des Alltags‘ heißt eben vor allem, dass ich so ein Haus selbstverständlich und selbstbewusst nutze: Manchmal geschehen dort großartige, faszinierende Dinge, und manchmal interessiert es schlicht nicht oder ist langweilig. Dann geht man eben und kommt demnächst mal wieder vorbei. Wir hatten tatsächlich schon Ausstellungen, bei denen Besucher bis 18 Jahren (ungeplant) mehr als ein Viertel der Gesamtzahl ausmachten.
Ja, und warum beteiligte ich mich, beteiligten wir uns nicht an der #KultDef-Blogparade? Ich glaube, wir waren da noch etwas zu frisch unterwegs mit unserem gerade gestarteten Blog und den dann bis Ende August massiv uns in Atem haltenden Aktivitäten zum Marta-Jubiläumsjahr 2015. Aber das wird sich bestimmt bei nächsten Mal ändern, so langsam werden wir ja Profis 😉
Und das „weiter so“ werden wir sehr ernst nehmen, versprochen!
Beste Grüße und Danke fürs Flauschen trotzdem,
Ihr
Roland Nachtigäller
P.S. (Siehe die gleiche Stelle in der Kommentarantwort zu Anke von Heyl)
Lieber Herr Nachtigäller,
wie fein, Polemiken führen zu Mehrwert. Vielleicht sind mir die Berichte im Blog zum Kinderprogramm untergegangen, komme auch nicht mit allem hinterher. Fände eine Berichterstattung darüber fein. Gehe ja auch mit meiner Kleinen ins Museum.
Kürzlich waren wir im Lehnbachhaus zu einem Kinderprogramm. Mini-Führung mit praktischen Teil in der Paul Klee und Kandinski-Ausstellung. Erst gähnt sie, dann war sie enttäuscht über ihr nicht „perfektes“ Bild, anschließend ging es zum praktischen Teil ins Atelier, das war ihr Ding. Und was machte sie abends zu Hause? Sie malte in einer Kombi aus den beiden Künstlern und sagte mit Inbrunst: „Nein, Mama, das mache ich nicht, weil ich es im Museum sah.“ So, so … toll war es!
Mein Passus mit #KultDef richtete sich allgemein an Museen, nicht an sie allein. Aber es ist schon sehr auffällig, das Museen nicht großartig, eigentlich gar nicht, in Post kommentieren und mitreden. Dann wird es natürlich schwer, wenn Museen möchten, dass ein Austausch mit ihnen erfolgt. Der muss ja gewünscht sein. Ich glaube auf ähnliches zielt auch @mikelbower ab (und bitte @michael, mach ruhig weiter, sei frech und unbequem!).
Danke für ihre Sicht darauf. Sie bewegen sich und allen kann man es eh nicht recht machen, muss man auch gar nicht.
Sonnige Grüße,
Tanja
P.S.: Auf das P.S. bin ich schon neugierig! Guten Rutsch!
Liebe Tanja Praske,
das werden wir auf jeden Fall nochmal als Anregung mit ins nächste Jahr nehmen, die konkrete Arbeit der Museumspädagogik etwas mehr auch im Blog abzubilden. Die Reaktion Ihrer Tochter jedenfalls würde bei uns ebenfalls jedeN BeteiligteN begeistern!
Eine frohe Weihnachtszeit
Roland Nachtigäller
Sehr geehrter Herr Direktor, küss die Hand der gnädigen Frau!
Tja… darf ich gerade mal stören? Und noch einmal provozieren? Ich werde das nicht mehr tun, überlasse den Kulturhistorikern & Co uneingeschränkt das Feld, das ist eh nichts für Amateure.
In der gesamten Blogparade wurde nicht einmal der Name eines der ausgestellten Künstler*innen erwähnt.
Leben sie noch? Haben sie eine Meinung dazu? Wird ihnen eine URL gegönnt?
Das Museum (samt Angestellten und potentiellen Angestellten) kommunizieren nur sich selbst, auf Augenhöhe!
Es ging doch um diese Beteiligung via Software? Das wurde angenommen, wie man in einem Halbsatz erfuhr. Gibt es da Zahlen?
Welche Paarungen wurden denn übernommen und warum? Ach so, dazu müsste man ja die Künstlernamen veröffentlichen und wer denn da die heilige Kommunion des Kurators erhalten hat. Die Sache mit der Transsubstantiation ist dabei ausdiskutiert?
Ich denke ich werde solche Paraden in Zukunft meiden. Partizipation ist Quatsch! #augenhöhe haha!
*verlässtdenelfenbeinturm und wünscht trotzdem allen eine gute Zeit! :))
Sehr geehrter Herr Bauer,
die gnädige Frau küsst hocherfreut zurück und lässt ausrichten, dass Sie keinesfalls Ihre Teilnahme an Blogparaden einstellen sollten. Ihre Einwürfe habe sie immer mit viel Schmunzeln verfolgt, vor allem auch weil sie so neugierig auf die Reaktionen sei. Zudem ist sie der Meinung, dass eine Diskussion allein unter KunsthistorikerInnen (aber so sei es hier ja zum Glück nicht gewesen) sehr rasch ermüde, z.B. auch die Pädagogen ausschlösse und dabei wenig Aufschlussreiches zur Vermittlungsfrage rumkäme. Sie schätze gerade die bunte Mischung der TeilnehmerInnen auf den online-Plattformen – und gibt damit grüßend zurück an „Herr Direktor“.
Ganz viele Künstlernamen finden Sie ansonsten im Blogpost „Paarweise denken“, der die vielen eingesandten Paarungen zusammenträgt. Welche dann aus welchen Gründen für die Ausstellung gewählt wurden, das diskutieren wir mit unseren Besuchern bei den Führungen und Begleitveranstaltungen. In meinen Augen würde das den Rahmen des Blogs etwas sprengen, aber ich frage gern nochmal in die Kuratorenrunge, ob jemand dazu noch etwas schreiben möchte.
Bei thematischen und Einzelausstellungen arbeiten wir sehr eng mit den beteiligten KünstlerInnen zusammen. Hier sind wir als KuratorInnen eher Ermöglicher und kümmern uns um die bestmögliche Präsentation der Werke innerhalb eines Ausstellungskonzepts. Bei Sammlungsausstellungen ist das etwas anders gelagert: Hier bietet sich sehr viel mehr Spielraum, experimentell z.B. nach Ideen aus dem museumspädagogischen Team oder nach ungewöhnlichen kuratorischen Ansätzen mit den Werken umzugehen. Ein gutes Beispiel dafür war unsere Ausstellung „Fragen wagen“ (Kurzvideo hier), bei der wir die KünstlerInnen durchaus ein wenig davon überzeugen mussten, einmal so frech mit ihren Bildern, Zeichnungen und Videos zu verfahren. Für das Publikum war diese Ausstellung ein völlig neues Erlebnis mit Kunst, aber das würde ich nur mit Sammlungsstücken machen, die wir auch in anderen Zusammenhängen schon gezeigt haben.
Lassen wir doch gemeinsam den Elfenbeiturm hinter uns und schauen uns weiter im Leben um!
Auch Ihnen alles Gute,
mit herzlichen Grüßen
Roland Nachtigäller
Ach so ja, ganz vergessen. Da hat außer den üblichen ein Museum geantwortet. Ein Museum. Hat niemand wirklich kommentiert. Das machte mich wirklich nachdenklich. Nicht, weil es um die Ecke ist, ich gerne mit den Kindern dort war, schon zwei mal bei einem Tweetup war, sondern weil es (Achtung hineininterpretiert) den „KUNSTLEUTEN“ peinlich ist mit dem Alltag konfrontiert zu werden. Nein kein Picasso dort, aber ich freue mich auf die neue Ausstellung zum Thema „Bier“ nächstes Jahr. Aber das ist ja nicht relevant, nicht war? Aber sonst ist alles gut!
Wir wären doch eigentlich schön blöd, wenn wir „Kunstleute“ dermaßen mit Scheuklappen herumliefen. Wie könnten wir da gesellschaftlich relevante Fragen mit künstlerischen Fragen verknüpfen? Unsere Ausstellung „Atelier + Küche = Labore der Sinne“ z.B. war auch ein großer kulinarischer Spaß, sinnenfroh, quer gedacht und voller Köstlichkeiten (im wörtlichen und im übertragenen Sinne). Da hätten Sie auch mit den Kindern Ihre Freude gehabt – getrübt vielleicht nur von der Quengelei während der weiten Anreise 😉
Lieber Herr Nachtigallen,
ich weiß nicht ob ich eine Olive bin. Ein Gummibärchen bin ich jedenfalls nicht. Sicherlich bin ich ein Teil eines Zuviel an Content, wobei mein Kommentar in Zusammenhang mit der Blogparade doch wirklich sehr kurz war – und weder eine Schmeichelei noch eine Ungenauigkeit. Ganz im Gegenteil: Ich war ziemlich genau. Ich habe respektvoll formuliert, dass gut gemeint nicht immer gekonnt ist. Wenn die Konzeption mit der Museumspraxis nicht vereinbar ist, stimmt etwas nicht. Es kann nicht sein, dass man fröhlich konzipiert, dann feststellt dass es an den Bildrechten scheitert und dann vor der Wahl steht es einzustampfen oder es auf Sparflamme umzusetzen. Zusammengefasst heißt das eben: Man wollte, aber man konnte nicht. Der Prozess müsste daher eigentlich in der anderen Reihenfolge verlaufen: Ausgehend von der Museumspraxis muss konzipiert werden. Ich verstehe, wenn Sie es leid sind „aus dem Mangel heraus zu argumentieren“ – aber sinnvollerweise muss man eben aus dem Mangel heraus konzipieren, wenn das Konzept am Ende stimmig und so wie geplant umsetzbar sein soll.
Ich habe in meinem Kommentar nicht unterstellt, dass Sie nicht weit genug gedacht hätten um eine Sharing-Funktion in Social Media einzuplanen. Es wurde nur eben nicht weit genug gedacht, dass sich das Konzept in der Form nur suboptimal umsetzen lässt, wenn die Bildrechte nicht geklärt werden können. Mir liegt es fern „armen Museumslemmingen den Kopf zu tätscheln“. Ich frage mich nur bis heute ob Sie mit dem ROI der Microsite (oder ist es eine Web-App – immerhin werden beide Formte für das Angebot synonym genannt, was verwirrt) zufrieden sind. Vielleicht hätten Sie das Budget doch lieber in die Kunstvermittlung investiert. Ich schreibe übrigens nicht mit „kompetentem kunsthistorischen Hintergrund“ sondern mit einem Marketinghintergrund. Ich mag, ebenso wie Sie, nicht beurteilen, wo hier die hierarchische Linie verläuft. Immerhin scheint so ein Dialog über das zu entstehen, was wir auf unseren unterschiedlichen „Augenhöhen“ sehen…
Viele Grüße, Angelika
Liebe Angelika Schoder,
oh, ich war hoffentlich weit davon entfernt, einzelne Personen als Oliven oder Gummibärchen zu titulieren. Sollte der Eindruck entstanden sein, so bitte ich vielmals um Entschuldigung, es war lediglich als Bild im übertragenen Sinne und nicht in Bezug auf Menschen gemeint! Und der Einschätzung Ihres Kommentars stimme ich absolut zu.
Widersprechen möchte ich nur bei der Beurteilung unserer Situation. Bildrechte sind unser tagtägliches Geschäft (und zwar in beide Richtungen) und ich kann Ihnen versichern, dass ich in den vergangenen Jahren auf diesem Gebiet Erfahrungen gemacht habe, von denen ich auf einige gut verzichten könnte. Insofern muss ich unsere Kuratoren und Museumspädagoginnen hier in Schutz nehmen: Es gab da keine plötzliche Überraschung, sondern die Sache verlief eher anders herum: Es war von vorn herein klar, was alles nicht geht (u.a. beispielsweise eine offene Sharing-Funktion), aber wir haben uns nach einigen Diskussionen dafür entschieden, das Experiment dennoch zu wagen – denn nix tun ist noch schlechter. Und die zum Teil großartigen Reaktionen, die im Blogpost „Paarweise denken“ in Auswahl zusammengetragen sind, geben uns aus meiner Perspektive auch recht. Dennoch stimme ich Ihnen absolut zu: Da ist durchaus noch Luft nach oben.
Ich muss gestehen, ROI habe ich erst mal bei Wikipedia nachgeschlagen, ich dachte erst, es sei ein Programmierbegriff, doch es steht, wie ich jetzt weiß, für die Rendite einer unternehmerischen Tätigkeit. Abgesehen davon, dass das Verhältnis von Kapitaleinsatz und Gewinn in kulturellen und Bildungszusammenhängen immer etwas schwierig zu objektivieren ist, würde ich dennoch klar mit JA antworten. Wir haben einen wundervollen Programmierer, der uns durchaus einen großzügigen „Kulturbonus“ gewährt, die Resonanz war höher als wir es uns erhofft hatten, es entstehen gerade interessante neue Besucherbindungen und die Investition war durchaus auch eine in die Museumspädagogik.
Ihre Anmerkungen und Kritik haben bei uns im Hause aber dennoch ihre Diskussionsspuren hinterlassen und wir werden auch weiterhin im kuratorischem und museumspädagogischen Team die Ergebnisse und Ereignisse reflektieren. Vielen Dank also nochmal dafür.
Mit herzlichen Grüßen
Roland Nachtigäller
PS: Ich korrigiere eigentlich ungern im Nachhinein noch am Text eines Posts, aber Ihren Hinweis auf die verschiedenen fachlichen Hintergründe wollte ich dann doch nicht einfach übergehen.
Lieber Roland,
dein Beitrag ist wie immer toll geschrieben, trotzdem erschließt sich mir die Essenz nicht vollständig. Unter Punkt 1 forderst du direkt weniger Flausch und mehr kritische Auseinandersetzung in der „Filterblase“, trotzdem sind es gerade die kritischen Posts auf die du so gar nicht weiter eingehst. Als Gegner von zuviel Flausch im Netz, bin ich nicht gerade für feine Beiträge bekannt und das gleiche gilt für Angelika. Nun würde ich auch behaupten, dass wir uns konstruktiv und ohne Lobhudelei geäußert haben. Kritik war also vorhanden, selbst polemische mit viel Reibungsfläche wurde durch Michael Bauer geliefert. Auch an dieser Stelle haben sie bereits, bisher leider unbeantwortet, kommentiert.
Nachdem Tabea eine Storify-mäßige gute Zusammenfassung der Blogparade geschrieben hat, war ich auf deinen Beitrag umso gespannter. Nun bin ich allerdings tatsächlich etwas ratlos. Ist außer dem Gefühl des Zuviel nichts geblieben? Was nehmt Ihr so mit für den Blog und wie handhabt Ihr das Thema Blogparaden in Zukunft? Das würde mich brennend interessieren. Und natürlich hätte ich auch wahnsinnig gerne deine Meinung zu der gebrachten Kritik gehört. Aus dem Mangel heraus zu argumentieren reicht mir nicht, da kann ich mich nur Angelika anschließen. Hier scheint mir tatsächlich noch einiges an Diskussionspotential.
Liebe Grüße
Michelle
Liebe Michelle,
Du hast es ja eine Zeit lang live mitbekommen, zumindest mein Arbeitsalltag im Museum schiebt das Bloggen fast immer in die Hobby-Ecke abend- bis nächtlicher Aktivitäten, denn im Terminsturm eines Tages ist die Beantwortung von Kommentaren nahezu ausgeschlossen – zumindest solange ich das nicht von unserem Online-Team übernehmen lassen (was ich bisher abgelehnt habe). Insofern muss ich da leider um Nachsicht und Geduld bitten.
Und wie es mit Polemiken so ist, sie sind einseitig, verallgemeinernd, pointierend und immer auch ein wenig ungerecht. Da weiß ich dann auch schon beim Schreiben, dass was zurückkommt. Meine leicht flauschallergische Reaktion kam, glaube ich, auch eher bei der Lektüre der vielen Kommentare zu den Posts, sollte aber auch nicht zu schwer auf der Waage liegen. Da liegt mir mein PS schon mehr am Herzen, und Du weißt, dass ich Deine Blogger-Aktivitäten so wie auch einige andere (soweit ich sie denn wirklich verfolgen kann) sehr schätze.
Eigentlich gefällt mir Deine Ratlosigkeit nach der Lektüre ganz gut. Letztlich spiegelt sie durchaus auch meine Situation, zumindest in der Zeit der geballten Materialsichtung. Mit jedem weiteren Tag aber klärt sich auch mehr. Nur denke ich nicht, dass es an mir ist, diese grundsätzliche Einschätzung der Blogparade vorzunehmen. Das werden wir auf einer der nächsten Redaktionssitzung nochmal sehr detailliert machen, und vielleicht schreibt ja auch nochmal jemand darüber. Wenn Du mein persönliches Resümee hören willst, das war eigentlich im Subtext schon übermittelt: Ich hätte niemals einen solch langen Post geschrieben, wenn mir die ganze Blogparade nicht auch viel Spaß gemacht hätte und vor allem zu einem reichen Fundus an Anregungen und Denkanstößen geführt hätte.
Auf jeden einzelnen Kritikpunkt einzugehen, wäre nicht nur äußerst kleinkariert geworden, sondern dafür wäre ich auch gar nicht der richtige Ansprechpartner. Vieles ist als kritische Rückmeldung auch einfach deshalb wertvoll, weil man erkennt, wie etwas „draußen“ ankommt, aber man gerät auch ganz schnell in eine sehr ungute Rolle, wenn das dann gleich mit Erklärungen und Rechtfertigungen gekontert wird. Da finde ich es sinnvoller, die Kritik aufzunehmen, auszuwerten und für die nächsten Schritte produktiv zu nutzen.
Und wie schon im Post formuliert und hier nochmal anders ausgedrückt: Wir argumentieren nicht aus einem Mangel heraus, das ist billig und kann jeder, sondern durchaus berechtigt aus einem Reichtum (auch wenn er vielleicht nicht pekuniär messbar ist).
Danke für Deine weiterhin engagiert Begleitung,
beste Grüße
Roland
PS: Und sollte eine #BesucherMacht-Frage von allgemeinem Interesse tatsächlich weiterhin brennend unbeantwortet geblieben sein, so können wir ja auch diese Kommentarfunktion zum nachträglichen Abarbeiten nutzen. Mit dem Thema Bildrechte aber, das ist jetzt schon klar, werde ich mich demnächst nochmal in einem eigenen Beitrag beschäftigen.
Zwischenruf mit neuen Zutaten
Lieber Herr Nachtigäller,
Danke schön für Ihre Gedanken! Blogposts zusammenfassen ist schwer; wohl auch weil es manchmal fast persönliche Porträts sind, und Menschen lassen sich nicht zusammenfassen.
Jetzt will ich aber ein wenig Knoblauch zu den Oliven tun und einmal klares Kontra geben. „Kommunikation auf Augenhöhe“ gibt es gar nicht?? Dann gibt es meiner Meinung nach keine Kommunikation! ‚Augenhöhe‘ ist eben Grundvoraussetzung. Was ist denn: „Gibt’s auch jemand, der höflich auf den Tisch haut, respektvoll klares Kontra gibt und leidenschaftlich widerspricht“? Das nenne ich Kommunikation auf Augenhöhe. Gegenseitiger Respekt plus der Versuch, seine eigene Meinung darzulegen plus der Versuch, einander zu verstehen. Keiner braucht sich herunterzubeugen und in die Knie zu gehen. Auch auf Bildung muss nicht verzichtet werden. Es geht nicht darum, weniger Bildung zu vermitteln und das Niveau zu senken. Es geht darum, quasi tausend Wege zu suchen um Bildungselemente so darzubieten, dass soviel wie möglich Leute den Zugang finden. Und das gelingt am Besten wenn das Engagement richtig spürbar ist. Das ist für mich Augenhöhe.
Arroganzvorwürfe brauchen auch nicht verschleiert zu werden. Ich habe früher Arroganz in Museen erlebt, und auch heute ist sie noch nicht völlig verschwunden – obwohl sich in den letzten Jahrzehnten sehr, sehr viel getan hat. Nur hat noch nicht jeder abgeschreckte und daher immer noch ferngebliebene Besucher das mitbekommen. Akademische Kunstgeschichte ist ein wesentlicher Teil eines Kunstmuseums und manchmal auch eines Museumbesuches, aber eben nicht das Ganze. Wo dennoch zu ihrer Gunsten eine Alleinherrschaft angestrebt wird, kämpft meine Besuchermacht dagegen an. Kunstgeschichte soll keine ‚herrschende‘ sondern eine ‚dienende‘ Wissenschaft sein – wie jede Wissenschaft.
Nun, Wortgefechte und Definitionskämpfe helfen nicht weiter. Beispiele sollen her. Ich hole sie in der Weihnachtszeit ‚aus Ägypten‘. Meine ‚Weisen aus dem Morgenland‘ heissen heute Ed Rodley und Roxane Bicker.
Ed Rodley vom Peabody Essex Museum in Salem (Massachusetts) erzählt in seinem Blogpost “My dear Henry Junior” von dem Brief, den der Ägyptologe George A. Reisner 1920 an den neunjährigen Sohn eines Freundes schreibt. Er zitiert den Brief vollständig und kommentiert: „I love this letter so much! It is so obviously written for a child, but without any of the condescension you might expect to find, particularly from a busy, industrious field archaeologist like Reisner, who by 1920 had been Director of the Harvard/Museum of Fine Arts Expedition excavating in the great necropolis of Giza for twenty years, a position he held until his death in 1942. […] It’s a little master class in communicating with a lay audience.“ Man beachte: „without any of the condescension“ – Reisner beugt sich nicht herunter …
Rodley’s Blogpost atmet die gleiche Gesinnung.
Roxane Bicker (aka @Arbabat) vom Ägyptischen Museum München stellt ihren gesamten Blog unter das Motto “ Lerne die Zukunft aus der Vergangenheit“ – das hat doch wohl mit Bildung zu tun. Einen tollen Willen zu „Kommunikation auf Augenhöhe“ wie bei Reisner und Rodley finde ich z.B. wieder in Roxane’s blogposts Stoppt eure Kinder nicht!, Der Eine und die Vielen und Das Finale – Assuan, Tag 10.
Der Begriff ‚auf Augenhöhe‘ ist mir letzendlich Wurst, die Sache aber nicht.
Ich wünsche Frohe Weihnachten!
Ihr Peter Soemers
Lieber Herr Soemers,
ich habe mich sehr gefreut, dass Sie sich noch einmal so viel Mühe für eine entschiedene Antwort gemacht haben. Ihre „Oliven“ schmecken mir sehr gut! Vor allem die Beispiele haben mir gemundet, und wahrscheinlich liegen wir in unseren Haltungen gar nicht so weit auseinander.
Anlass meines Aufbrausens war vor allem dieses vielfach nachgeschobene „… aber auf Augenhöhe!“, bei dem man sich zunehmend fragt, was damit eigentlich gemeint sein soll. Ich bin ein großer Freund der Unterschiede, aber der empathisch gelebten und der überbrückten. Vielfalt ist der Kern jeder Entwicklung. Und wie Sie es schon richtig erwähnen, es gibt den direkten Zugang zur Kunst, zum Museum, zur Geschichte und es gibt die Wissenschaft. Auch sie hat nicht nur ihre Berechtigung, sondern auch ihre Bedeutung. Und es gibt auch die Praxis der Künstler, die nicht nur den unvorbereiteten Museumsbesucher überzeugen soll, sondern auch die Kollegen vom Fach und für das späte Urteil der Geschichte. Kein ganz leichter Spagat. Dazwischen jedenfalls gibt es unendlich viele Abstufungen des Wissens, des Wollens und der Möglichkeiten. Damit müssen wir, aber damit wollen wir auch umgehen.
Insofern stimme ich Ihnen spätestens bei Ihrem letzten Satz über die Augenhöhe zu: Wenn wir das Floskelhafte beiseiteschieben und uns um zugewandte, ehrliche Kommunikation bemühen, dann sind wir auf dem besten Weg.
Auch Ihnen ein fröhliches Weihnachtsfest und in 2016 noch viele belebende Kunst- und Kulturmomente.
Herzlichst
Ihr
Roland Nachtigäller