Chinesische Splitter II
Eine Woche war eine Herforder Gruppe um den Unternehmer, Sammler und Freundeskreisvorsitzenden Heiner Wemhöner in China zwischen Shanghai, Hangzhou und Changzou unterwegs. Dies ist der zweite Teil meiner Sammlung einzelner Begebenheiten und Eindrücke einer äußerst vielfältigen Reise.
Hochhäuser im Dschungel
Die Zeitangabe unserer chinesischen Reisebegleiterin für Busfahrten, egal ob von einem Bezirk in den nächsten oder über die Autobahn in die nächste Großstadt: „etwa eine halbe Stunde“. Dass daraus bisweilen zwei ganze wurden, ist ihr kaum anzulasten, denn der Verkehr ist weitestgehend unberechenbar. Überall staut es sich, es hupt und schiebt sich vor und ineinander, und zumindest aus der reinen Beobachtung lassen sich keine verbindlichen Verkehrsregeln erkennen. Nicht nur wir, sondern auch Gesprächspartner, die länger schon in China sind, betonen, dass man sich das eigene Autofahren in Shanghai und Umgebung lieber erspart. Einen guten Eindruck von den Gepflogenheiten der Straße geben immer wieder die Taxifahrer, und gerade wenn der Verkehr nachts etwas ruhiger wird, scheint es kein Halten vor nichts zu geben: Geschwindigkeiten, Spurvorgaben, Fahrtrichtungen – alles ist ziemlich frei interpretierbar.
Und überall wird gebaut. Vor allem Hochhäuser schießen auf jedem freien Stück Land in die Höhe, in den Geschäftszentren der Metropolen auffällige Solitäre, in den Randbezirken und neuen Siedlungen vor allem Ensembles von gleichen Säulen mit 30 und mehr Stockwerken. Viele sehen aus wie klassische europäische Siedlungshäuser, die einfach nur auseinandergezogen, übereinandergesetzt, und mit Gesimsen unterteilt werden. In luftiger Höhe schließt nicht selten ein Spitzdach mit Türmchen und Gauben den Turm ab. Und – alles, was dann noch an Freifläche zwischen den Gebäuden bleibt, wird begrünt, von Ferne hat man gar den Eindruck: bewaldet. Wie aus einem Dschungel steigen die Bauwerke aus dem grünen Teppich in den Himmel.

So scheint die Erschließung eines Industriegebietes etwa nach folgendem Plan abzulaufen: Zuerst (wie überall) die Straßen, gern in rechteckigem Sektorraster, auf jeden Fall breit, vierspurig und nach unseren Maßstäben in Autobahnformat. Dann sogleich auf Mittel- und Randstreifen die Begrünung, kilometerlang erstrecken sich in leerer Landschaft sorgfältig gepflegte Blumenbeete, Hecken und Gebüsche, immer in feiner Staffelung mit Gespür vor Vorder- und Hintergrund. Und Bäume dürfen keinesfalls fehlen, aber nicht die in unseren Breiten landläufig bekannten dürren Stecken, sondern große, bis zu fünf Meter hohe, kräftige Stämme mit vorsichtig gestutzten Ästen werden zu Hunderten verpflanzt, mit Balken gehalten und bilden bereits nach einem Jahr prächtige Alleen. Als wir zur Grundsteinlegung für das neue Werk der Wemhöner Technologies fahren, landen wir in einem nahezu unbebauten Gebiet, die Grundstücke sind notdürftig geräumte und gepflügte Brachflächen, aber die gesamte Infrastruktur ist einer Bundesgartenschau würdig.
Quallen mit Schnabel
Ich bin eigentlich Vegetarier, das heißt, seit längerem esse ich kein Fleisch aus industrieller Produktion. Es war vor allem eine politische Entscheidung, die (vielleicht einmal im Jahr) ein gutes Stück Wild, das von einem ostwestfälischen Jäger geschossen und serviert wird, nicht ausschließt. Und auch eine China-Reise setzt diesen Entschluss temporär außer Kraft. Man kann sich einfach nicht auf ein Land einlassen, dessen Ernährung zu sehr großen Teilen auf Geflügel, Fisch und unterschiedlichste Fleischsorten mit Gemüse basiert, ohne diese umwerfende Vielfalt der chinesischen Küche auch in ihrer Vollständigkeit zu genießen.

Sehr schnell bei unseren Essen, die immer in großer Runde um sich drehende Tischplatten stattfanden, haben wir es aufgegeben, VOR dem Verzehr in Erfahrung zu bringen, was uns denn hier serviert wird. Die abwechslungsreiche Speisenfolge aus bis zu 14 verschiedenen Gerichten, von denen sich immer alle ein wenig auf den Teller füllen sollen, verwirrt die Sinne nachhaltig. Farben, Konsistenzen und Düfte leiten bisweilen in völlig falsche Richtungen, Unterscheidungen nach pflanzlich oder tierisch sind für das ungeübte Auge kaum mehr zu treffen und Geschmackserwartungen werden immer wieder komplett ins Gegenteil geführt. Was einzig konstant bleibt: Es schmeckt fast alles grandios: pikant, sanft, elegant, mit einer leichten, nicht zu aufdringlichen Schärfe, sauer oder verführerisch kandiert, knusprig oder samtweich. Wir haben die Wurzeln von Lotuspflanzen gegessen und den Magen von Karpfen, Shrimps wie Chips mit Kopf und Panzer verzehrt, goldgelbe Quallenhappen in Kokosnuss probiert und warmen, weichen Tofu mit Zwiebeln und Kräutern als delikaten Zwischengang genossen.
Am Ende, wenn dann etwas serviert wird, was selbst das westliche Auge sofort und zweifelsfrei identifiziert, wenn also eine kleine Schale Reis auf den Tisch gestellt wird, ist man so pappsatt, dass man davon kaum mehr kosten möchte. Und genauso soll es sein. Im privaten Kreis beleidigt man die Gastgeber, wenn man von diesem Reis noch nimmt, denn dann war die Mahlzeit nicht ausreichend. Im Restaurant wird das weniger genau beobachtet, aber auch so lassen wir diese abschließende Sättigungsbeilage fast unberührt stehen.
Nach sechs Tagen China, mit zwei warmen Mahlzeiten pro Tag, immer mit viel Fisch, Krustentieren und Fleisch, mit den merkwürdigsten Pilzen, Wurzeln und Gemüsen, kehre ich am Ende mit einem knappen Kilo weniger Gewicht zurück nach Hause. Und erst hier fällt mir auf, dass wir nahezu kein Brot (außer vielleicht beim kontinentalen Frühstück) und keinerlei Käse und Milch (außer beim nur einmal bestellten und nicht wirklich guten Latte macchiato) zu uns genommen haben. Mir ist selten eine ausländische Küche besser bekommen – und auch der etwas stolze Schauder war selten so schön, wenn unsere chinesische Begleitung dann die verschiedenen Speisen und ihre Ingredienzien erläuterte oder im weinrot eingelegten Entenragout am Ende auch der Schnabel entdeckt wurde …

Fliegende Dächer und tanzende Tusche
Der Besuch der Chinesischen Hochschule der Künste in Hangzhou, genauer des Xiangshan Zentralcampus, ist eine kleine Sensation. Plötzlich stehen wir inmitten einer Art Gartenanlage. Ungewöhnliche geschnittene Gebäude aus Holz und Beton, aus Backstein und Dachziegeln stehen am und im Wasser, verbunden mit Gängen, Stegen und Brücken, rhythmisiert mit Balkonen und unregelmäßigen Fensteröffnungen (vergleiche auch das Artikelbild oben). Wang Shu hat mit seiner Frau Lu Wenyu (Amateur Architecture Studio) dieses faszinierende Ensemble konzipiert und gewann dafür als erster chinesischer Architekt gleich den hoch renommierten Pritzker-Preis. Es sind vor allem die „spektakulären Neuinterpretationen einer traditionsbewussten Architektur“, die dem Büro weltweite Aufmerksamkeit zukommen lassen: „Die Archaik ihrer Bauten weckt dabei unweigerlich Assoziationen zum reichen chinesischen Bauerbe.“ (Wikipedia) Und so stoßen wir auf Mauern aus gestapelten, wiederverwendeten Dachschindeln, auf tanzende, unregelmäßig geschnittene Fensterfronten, auf hölzerne Treppengeländer mit Stahlauflagen, auf Naturstein- und immer wieder auf kunstvoll integrierte Lehmwände, die in keinerlei Gegensatz stehen zur großen Betonstruktur. Das ziehharmonikaartige Holzdach tanzt wie eine große Welle über dem Komplex und ruht als gigantisches Faltwerk ohne Trägerbalken schwebend leicht auf einzelnen Zwischenwänden. Ein Gebäude so weltläufig wie privat, so grandios wie behütend.
Dieses Aufeinanderprallen von Tradition und Innovation, entschlossenem Aufbruch in eine neue Zeit und der völlig unsentimental erscheinenden Auseinandersetzung mit der Vergangenheit finden wir wenig später auch noch einmal im Sanshang Art Museum in Hangzhou. Hier zeigt der große Kalligraphie-Meister Wang Dongling unter dem Titel „Writing Non-Writing“ seine jüngsten Werke, Schriftbilder, die die chinesischen Zeichen immer weiter in die Abstraktion treiben, Text zwischen Lesbarkeit und Überlagerung zum Bild werden lassen. Manche Leinwand, manches Großpapier erinnert dabei nicht nur oberflächlich an die Ecole de Paris, an Bilder von Hans Hartung und Pierre Soulage. Nur verläuft die Bewegungsrichtung hier anders herum: Aus dem konkreten Text entwickelt sich mehr und mehr das abstrakte Bild. Für jeden chinesischen Besucher aber entsteht ein beziehungsreiches Wechselspiel zwischen den Zeichen und ihren rudimentären Bedeutungen, zwischen lesbaren Textfragmenten und der freien Entfaltung meisterhafter Pinselstriche. Wie global kann man Kunst betrachten, gar beurteilen?
3,5 Millionen Menschen ohne Museum

Letzte Station unserer Reise ist Changzhou, wieder eine Stadt mehr als doppelt so groß wie Hamburg und mit einer über 2500 Jahre alten Geschichte. Abgesehen von einem riesigen Dinosaurierpark bekommen wir von einem historischen Bewusstsein erst einmal wenig zu sehen. Die Behörden setzen beim Städtewachstum hier vor allem auf die Ansiedlung von Unternehmen im Bereich Silicium-Recycling und Solartechnik sowie den Bau der dazugehörigen Verkehrs- und Wohnstrukturen. Am weitläufigen Gehu-See entsteht zudem ein 19 Quadratkilometer (!) großes Gelände für Tourismus, Gesundheitsversorgung und Industrie (!) – Dimensionen, die auch bei der Schnellbesichtigung per Bus kaum vorstellbar werden.
Aber – und das erfahren wir dann von einigen Künstlern abends beim gemeinsamen Dinner – noch gibt es in der ganzen Stadt kein Museum, erst recht nicht für bildende oder gar zeitgenössische Kunst. Und so wächst in dieser Nacht beim gemeinsamen „gan bei“-Trinken (ja, auch Wein wird „auf ex“ mit dem Gegenüber getrunken) der kühne Gedanke, hier vielleicht Neues zu initiieren. Wäre es nicht großartig, wenn es demnächst einen Museumsraum in Changzhou gäbe, der einmal im Jahr eine Ausstellung von Marta Herford übernimmt und im Gegenzug eine eigene Präsentation nach Ostwestfalen schickt? Noch ist es eine Vision quer über den halben Globus, aber viel voneinander zu lernen gäbe es allemal …
Wie es begann
Teil I der „Chinesischen Splitter“
3 Replies to “Chinesische Splitter II”
Comments are closed.



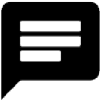
Oh, wie großartig! Es geht um’s Essen! Das beschreiben Sie hervorragend und ich bewundere Ihren Mut. Ich hätte mich wahrscheinlich nicht so viel getraut! Es klingt aber alles sehr spannend.
Danke für diesen zweiten Bericht! Und am Ende kommt dann noch ein Knaller 🙂 Bin sehr gespannt, ob Sie da etwas umsetzen können. Ich drücke die Daumen, dass das nicht im Behördendjungel stecken bleibt!
Viele Grüße
Anke von Heyl
Falls aus den kühnen Visionen einmal reale Möglichkeiten entstehen, werden wir die Geschichte sicherlich hier weiter erzählen. Vorerst aber vielen Dank für die engagierte Begleitung! Und beim Essen sollten wir uns alle viel mehr trauen …
Herzlichst
Ihr
Roland Nachtigäller